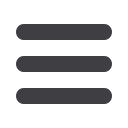
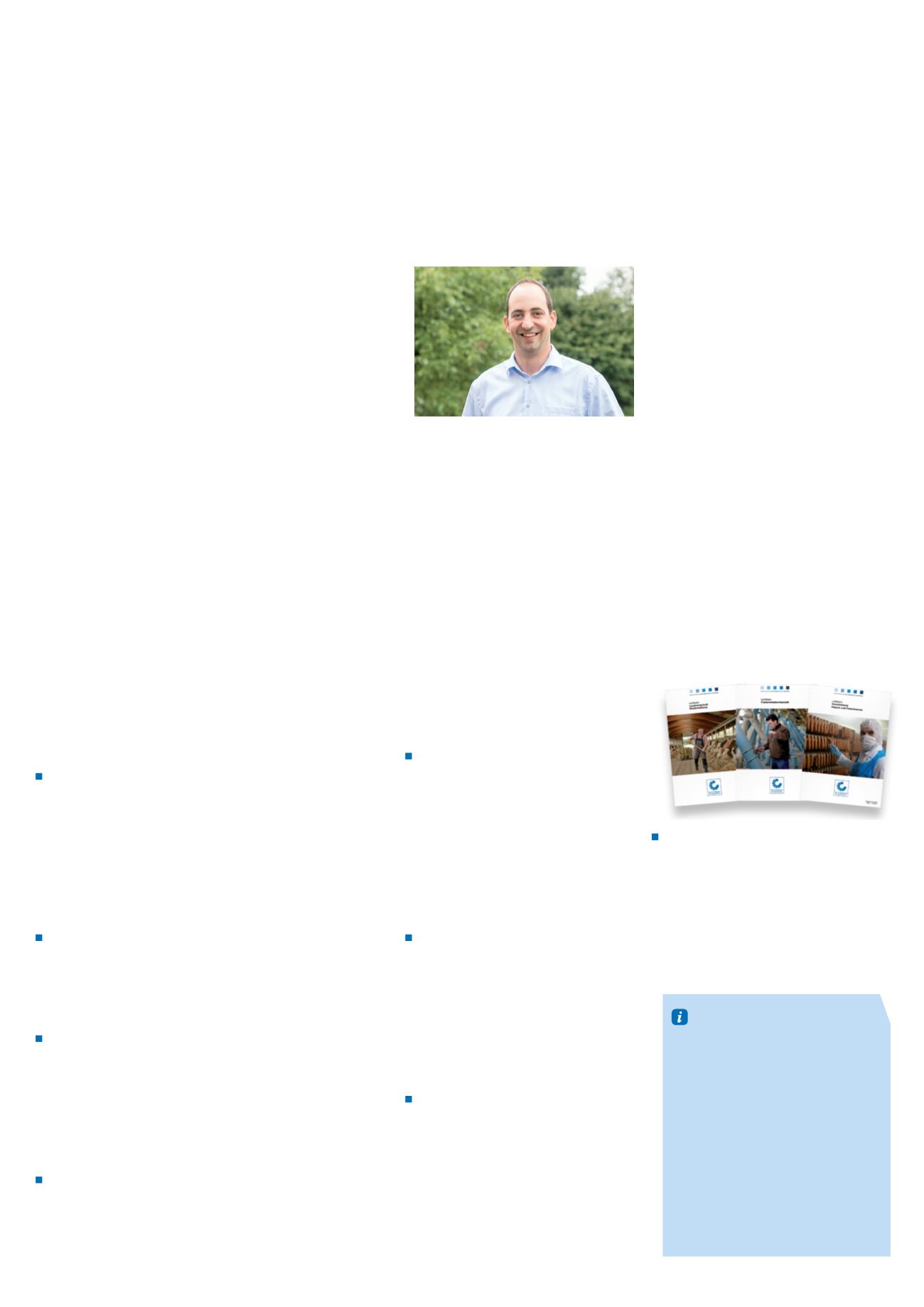
3
QS-Report:
Fleisch und Fleischwaren | Ausgabe November/2017
sind, auch wenn hier und da noch „Un-
gereimtheiten“ auftreten, die geprüft
werden müssen“
, so Klauke weiter. Die
vollständigen Ergebnisse der Praxispro-
jekte werden Ende des Jahres vorliegen.
Komplexe Berechnung der TGIs
Ein einziger TGI als Kenngröße für die
Tiergesundheit bleibt das Zielbild.
Zunächst haben wir vier Teilindices
gebildet, und zwar für Atemwegsgesund-
heit, Organgesundheit, Gelenkgesundheit
und Unversehrtheit des Schlachtkörpers.
Die Werte für die Indices liegen zwischen
0 und 100, wobei 0 das schlechteste
und 100 das beste Ergebnis bedeutet. Bei
In Deutschland wird kein Schwein geschlachtet, ohne dass seine
Organe nach der Schlachtung von einem Tierarzt untersucht werden.
Die bei der amtlichen Schlachttier- und Fleischuntersuchung erho-
benen Befunddaten werden aktuell von 90 Schlachtbetrieben an die
QS-Befunddatenbank weitergegeben. Die dort gespeicherten Daten-
sätze zu mittlerweile mehr als 100 Millionen Schweineschlachtkör-
pern bilden ein stabiles Fundament für zielgerichtete Auswertungen
und zur Bildung von Tiergesundheitsindices (TGIs). Aktuell werden
die TGIs in vier Praxisprojekten mit dem Erzeugerring Westfalen, der
landwirtschaftlichen Qualitätssicherung Bayern (LQB), Westfleisch
und der VzF auf Herz und Nieren geprüft.
Für diese Praxisprojekte öffnen Mastbetriebe ihre Stalltüren für Fach-
berater, die die berechneten Indices mit den Gegebenheiten vor
Ort vergleichen. Sollte es etwa auf einem Hof mit einem TGI von 100
(maximal erreichbare Punktzahl) in der Realität nicht so perfekt aus-
sehen, gilt es, herauszufinden, wo die Gründe dafür liegen.
„Mehr
als 20 unserer Mitgliedsbetriebe haben sich spontan für diesen
Praxistest zur Verfügung gestellt und ihre Daten dafür freigegeben“
,
berichtet
Dr. Thorsten Klauke
vom Erzeugerring Westfalen (Bild).
„Unsere Berater haben schon einige dieser Betriebe besucht und
die Angaben, die wir von QS erhalten haben, mit den Gegebenhei-
ten vor Ort abgeglichen. Erste Rückmeldungen zeigen, dass wir mit
der Berechnung der Tiergesundheitsindices auf einem guten Weg
Auf Herz und Nieren
Teilindices zur Tiergesundheit auf dem Prüfstand
den vier Teilindices handelt es sich nicht um
physikalische Größen, die einfach gemes-
sen und angegeben werden können, wie
etwa bei der Temperatur. Vielmehr basiert
die Berechnung auf komplexen statis-
tischen Verfahren, die die Unterschie-
de bei der Befunderfassung zwischen
den einzelnen Schlachtbetrieben aus-
gleichen. Federführend bei der Aufstel-
lung und Fortentwicklung der TGIs ist
Professor Dr. Joachim Krieter von der
Christian-Albrechts-Universität Kiel. Durch
einen intensiven Austausch mit Experten
aus Praxis und Wissenschaft und nicht
zuletzt mit Hilfe der aktuellen Praxis-
projekte, werden Indices entwickelt,
die die Tiergesundheit im landwirt-
schaftlichen
Betrieb
abbilden
und
eine
Vergleichbarkeit
ermöglichen.
Die Landwirte erhalten künftig quartals-
weise eine Rückmeldung über die berech-
neten Indices zu jeder Befundgruppe und
können ihr Ergebnismit den Indices anderer
Betriebe vergleichen.
Leitfäden individuell
zusammenstellen
Im Dokumentencenter der QS-Webseite
können Sie die Leitfäden der Land-
und Futtermittelwirtschaft mit einem
PDF-Generator individuell zusammen-
stellen. Dabei können zu den jeweiligen
Basisleitfäden die Zusatzkapitel
(z.B. Tiertransport, VLOG-Zusatzmodul,
Initiative Tierwohl) beliebig hinzugefügt
und als Gesamtdokument herunter-
geladen werden.
Revisionen 2018
Die wichtigsten Neuerungen auf einen Blick
Landwirtschaft Rinder-, Schweine- und Geflügelhaltung
Die Leitfäden Landwirtschaft Rinderhaltung, Schweinehaltung
und Geflügelhaltung werden neu strukturiert, um wichtige An-
forderungen besser zu verdeutlichen und eine akzentuierte
Bewertung zu ermöglichen. Gleichzeitig wird eine klare Unter-
scheidung vorgenommen zwischen Anforderungen, die als Prüf-
kriterien kontrolliert werden und Hinweisen, Anregungen und
Erläuterungen, die nicht überprüft werden.
Tränken, die oberhalb des Troges angebracht sind, können
künftig als alleinige Tränkestelle angerechnet werden.
Voraussetzung dafür ist, dass die Tiere nur rationiert gefüttert
werden und ein 1:1 Tier-Fressplatz-Verhältnis besteht.
Eine Änderung der Bewertungsmöglichkeit im Betreuungsver-
trag Hoftierarzt stellt ab 2018 kein K.O.-Kriterium mehr dar.
Die Anforderungen in Bezug auf die Schädlingsbekämpfung und das
Schädlingsmonitoring , die eine besondere Sachkunde beim Einsatz
von Rodentiziden der II. Generation vorsehen, werden gestrichen.
Futtermittelwirtschaft
Unternehmen, die Lebensmittel von Lebensmittelherstellern bezie-
hen und zu Futtermitteln aufbereiten, finden zukünftig im Leitfaden
Futtermittelwirtschaft ein neues Kapitel mit Beschaffungsanforde-
rungen, die beim Bezug von ehemaligen Lebensmitteln gelten.
Mutterkorn und Ochratoxin (OTA) werden
in die Kontrollpläne für Mühlenfuttermittel,
Mischfuttermittel sowie in den Kontrollplan
für Händler von Getreidekörnern aufgenom-
men. Blausäure wird im Kontrollplan für
Ölsaaten und Ölfrüchte, sonstige öllie-
fernde Pflanzen, deren Erzeugnisse und
Nebenerzeugnisse ergänzt.
Die Gate-Keeper-Regelung wird um eine
Verpflichtung erweitert, wonach sämt-
liche Rohwaren und Lieferanten, für die
das Gate-Keeping angewendet wird, in
der QS-Softwareplattform hinterlegt wer-
den müssen.
Fleischwirtschaft/LEH
Die Anlage 7.2 „QS-Kennzeichnung bei
Convenience Produkten“ wird in „Kenn-
zeichnung auf Endverbraucherverpackun-
gen“ umbenannt. Hintergrund ist, dass
die bisher ausschließlich für Convenience-
Produkte geltenden Regelungen zur
Kennzeichnung künftig für alle zusam-
mengesetzten Produkte gelten.
Der Leitfaden Lebensmitteleinzelhandel
wird um ein Zusatzkapitel für den Online-
handel ergänzt. Die neuen Regelungen
betreffen insbesondere die Bereiche
Trockenlager, Kommissionierung und Wa-
renausgang, Versand/Transport, Retouren
und Reklamationsmanagement.


















